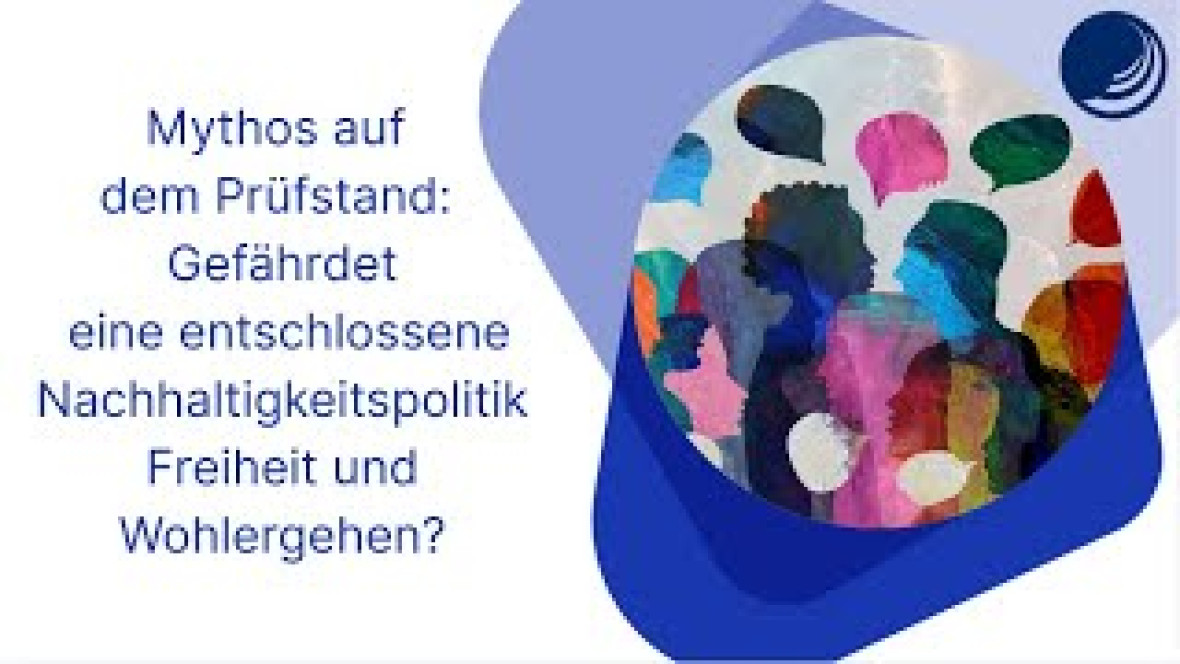Mythos auf dem Prüfstand: Gefährdet eine entschlossene Nachhaltigkeitspolitik Freiheit und Wohlergehen?
29.09.2025

Starke Politiken für nachhaltigen Konsum bedrohen unsere Freiheit und unser Wohlergehen. Sie werden niemals akzeptiert werden.
Das ist die Geschichte, die uns erzählt wird, insbesondere von rechten Akteuren. Aber ist sie wahr? Was wäre, wenn entschlossene Maßnahmen für nachhaltigen Konsum uns nicht einschränken, sondern eine bessere, gerechtere Welt für alle schaffen könnten?
Derzeit werden vor allem schwache Politiken für nachhaltigen Konsum umgesetzt, die sich auf Effizienz und Technologie konzentrieren. Dabei ignorieren sie das tieferliegende Problem: Um ein gutes Leben für alle innerhalb der planetaren Grenzen zu ermöglichen, müssen wir den Gesamtverbrauch von Ressourcen reduzieren. Freiheit ist in diesem Sinne nicht gleichzusetzen mit endlosem Konsum – sie bedeutet vielmehr, faire Chancen für alle zu gewährleisten.
Wie also kann dieser Mythos entkräftet und echter Wandel herbeigeführt werden? Dieser Frage gehen wir in einem Kapitel des Sammelbands „Dispelled: Myths about Sustainable Consumption“ (in Kürze erscheinend) nach, der von Oksana Mont von der Universität Lund herausgegeben wird. Dieser Blogbeitrag fasst die zentralen Argumente zusammen und legt dar, warum starke Politiken für nachhaltigen Konsum unverzichtbar sind, um unsere Freiheit zu schützen und ein gutes Leben für alle zu ermöglichen.
Ursprünge
Warum ist es so schwer, zu einem wirklich nachhaltigen Konsum zu gelangen?
Weil es um Macht geht.
Unsere Wirtschaft basiert auf Wachstum – endloser Expansion, mehr Produktion, mehr Konsum. Und die Akteure, die davon am meisten profitieren – große Unternehmen, Unternehmensinvestor*innen – haben Macht. Sie gestalten Politik, kontrollieren Narrative und überzeugen uns davon, dass mehr Konsum gleichbedeutend mit Wohlergehen ist. Das Ergebnis sind schwache Maßnahmen für nachhaltigen Konsum, die die Menge des Konsums insgesamt nicht antasten. Echter Wandel hingegen wird als unmöglich abgetan.
Aber die wirtschaftliche Seite ist nicht alles. Konsum ist auch von sozialer Bedeutung. Menschen nutzen Luxusgüter als Statussymbole. Sozialwissenschaftler*innen bezeichnen dies als „Geltungskonsum“. Andere betreiben „Kompensationskonsum“ – sie kaufen, um mit Stress und unbefriedigenden Lebensbedingungen fertig zu werden. Die Einschränkung von Konsum fordert also nicht nur Unternehmen und Investor*innen heraus, sondern tief verwurzelte Vorstellungen von Freiheit und Wohlergehen.
Daraus erwächst der machtvolle Mythos, dass eine engagierte Politik für nachhaltigen Konsum unsere Lebensweise bedrohe. Doch welche Folgen hat dieser Mythos?
Konsequenzen
Der Begriff Nachhaltigkeit ist allgegenwärtig – er taucht auf Verpackungen und in politischen Reden genauso auf wie in Werbung für die neuesten Elektro-SUVs.
Trotzdem schreiten Umweltzerstörung und die Vergrößerung sozialer Ungleichheit weiter voran - vom Erreichen der Klimaziele sind wir weit entfernt.
Denn schwache Politiken für nachhaltigen Konsum, die eher auf Effizienz als auf systemische Veränderungen abzielen, zementieren den Status quo. So steigt der weltweite Ressourcenverbrauch weiter an, obwohl wir immer mehr recyceln. So verdienen Lebensmittelkonzerne Milliarden, während Landarbeiter*innen mit Ernährungsunsicherheit zu kämpfen haben. Und so reden Regierungen über Nachhaltigkeit, vermeiden aber Maßnahmen, die die Macht der Konzerne und ihre nicht-nachhaltigen Praktiken wirklich einschränken könnten.
Für die meisten Unternehmen ist Nachhaltigkeit zu einem Marketinginstrument geworden, nicht zu einer Verantwortung. Diese wird indes auf einzelne Konsument*innen abgewälzt, die zu „besseren“ Konsumentscheidungen angehalten werden. Sie sollen so Verantwortung für ökologische Krisen übernehmen, auf die sie nur sehr begrenzten Einfluss haben. Tief verwurzelte Ungleichheiten bleiben bestehen.
Das Ergebnis ist eine Welt, in der Nachhaltigkeitsbemühungen paradoxerweise gerade die Nicht-Nachhaltigkeit aufrechterhalten. Echtes Wohlergehen rückt zusehends in die Ferne, während der Mythos fortbesteht, dass starke Politiken für nachhaltigen Konsum die Lebensqualität beeinträchtigen würde. Doch was ist da wirklich dran?
Mythos widerlegt
Dass eine ambitionierte Politik für nachhaltigen Konsum Lebensqualität und Freiheit mindern und daher auf breite Ablehnung stoßen würde, ist eine tief verwurzelte Überzeugung. Sie ist jedoch in einem ökonomischen und sozialen System begründet, das Wirtschaftswachstum über menschliche Bedürfnisse stellt. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass gut konzipierte starke politische Maßnahmen für nachhaltigen Konsum Wohlergehen verbessern und gleichzeitig ökologische Nachhaltigkeit gewährleisten können. So lässt sich der Mythos anhand fünf zentraler Argumente entkräften:
Erstens basiert Lebensqualität allem voran auf der hinreichenden Erfüllung unserer universellen Bedürfnisse wie Nahrung, Gesundheit, Gemeinschaft und Sicherheit. Diese Bedürfnisse sind kulturell und sozial übergreifend und bilden die Grundlage jedes menschlichen Lebens. Ein Beispiel für eine starke Nachhaltigkeitspolitik, die auf dieser Einsicht basiert, liefert die Initiative „Sustainable Food” in Barcelona: Sie bietet subventionierte pflanzliche Mahlzeiten in öffentlichen Einrichtungen an und reduziert so die Umweltbelastung und fördert die Gesundheit. Diese Art von Politik schadet gesellschaftlichem Wohlergehen nicht, sondern fördert es, indem sie allen Menschen einen Zugang zu gesunden, nachhaltigen Lebensmitteln bietet. Sie zeigt, dass nachhaltige Politiken universelle menschliche Bedürfnisse erfüllen und gleichzeitig ökologische Schäden reduzieren können.
Zweitens bedeutet Freiheit mehr als nur unbegrenzte Wahlmöglichkeiten. In der Mainstream-Darstellung wird der Begriff oft mit der Möglichkeit gleichgesetzt, jederzeit alles kaufen zu können, was man will. Doch das ist ein sehr schwaches und eingeschränktes Verständnis von Freiheit. Freiheit, als Grundrecht, bedeutet vielmehr Handlungsfähigkeit – die Fähigkeit, so zu handeln, dass man seine Werte zum Ausdruck bringt und zum Gemeinwohl beiträgt. Diese Perspektive widerspricht dem Mythos, dass starke Politiken für nachhaltigen Konsum individuelle Freiheit bedrohen. Vielmehr sind diese darauf ausgerichtet, dass wir unsere persönliche Freiheit ausüben können, um Gesellschaft zu gestalten und Gemeinwohl durch demokratische Teilhabe zu fördern. Dies kann beispielsweise durch ein aktives Engagement in Initiativen zur Förderung von Nachhaltigkeit geschehen – wie lokale Begrünungsprojekte, solidarische Landwirtschaft oder partizipative.
Drittens erhöht nachhaltige Wohlfahrtsstaatlichkeit nachweislich die Lebensqualität in der Breite der Bevölkerung. Gegenwärtige Sozialsysteme hingegen sind von anhaltendem Wirtschaftswachstum abhängig und fördern einen hohen Konsum. Dieses Modell schadet jedoch nicht nur der Umwelt, es erhält und schafft auch Ungleichheit. Im Gegensatz dazu können stark nachhaltige Sozialpolitiken, die Bedürfnisbefriedigung ins Zentrum stellen – wie eine universelle Grundversorgung in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Verkehr – allen Menschen bieten, was sie brauchen, ohne die Umwelt übermäßig zu schädigen. Nehmen wir den öffentlichen Nahverkehr: Die Nutzung steigt, wenn er sowohl gut ausgebaut als auch kostenlos oder zumindest günstig ist, wodurch wiederum die Abhängigkeit vom Auto sinkt. Diese Art der ökosozialen Wohlfahrt verbessert Lebensqualität und reduziert gleichzeitig Emissionen.
Viertens kann die Beseitigung spezifischer Hindernisse diese Maßnahmen akzeptabler machen. Menschen lehnen starke Politiken für nachhaltigen Konsum oft aufgrund von Bedenken hinsichtlich Kosten, Komfort und kulturellen Normen ab. Wenn diese Bedenken jedoch ausgeräumt werden – indem nachhaltige Optionen erschwinglich, praktisch und zugänglich gemacht und Aufklärungskampagnen durchgeführt werden –, steigt auch die Akzeptanz. Wenn beispielsweise, wie in Barcelona, eine pflanzliche Ernährung leicht gemacht würde und die Bahn attraktiver als das Flugzeug wäre, würden die Menschen diese Veränderungen eher akzeptieren.
Schließlich sind Konflikte und Kontroversen für echten Wandel unerlässlich. Ambitionierte Maßnahmen für nachhaltigen Konsum stellen festgefahrene Machtstrukturen und tief verwurzelte Überzeugungen in Frage. Fragen des Konsums und des Lebensstils werden insofern immer kontrovers diskutiert werden. Doch genau das brauchen wir, um bessere Zukünfte zu entwerfen und einen transformativen Wandel herbeizuführen. Eine zu starke Ausrichtung auf Konsens kann bestehende Konflikte verschleiern und marginalisierte Ideen, Interessen oder Identitäten unterdrücken. Um tief verwurzelte Hindernisse für den Wandel fair und nachhaltig zu überwinden, brauchen wir offene, inklusive und auch konflikthafte Gespräche. Das bedeutet, miteinander zu reden und zuzuhören sowie konstruktiv mit Meinungsverschiedenheiten umzugehen. Indem wir zum Beispiel soziale Bewegungen und kontroverse öffentliche Debatten unterstützen, schaffen wir Momentum, um unsere Systeme nachhaltiger zu machen. Nur die Kombination verschiedener demokratischer Praktiken kann einen Wandel ermöglichen, der gesellschaftliches Wohlergehen über Wirtschaftswachstum allein stellt.
Kurz gesagt: Anstatt Wohlergehen zu gefährden, können starke Politiken für nachhaltigen Konsum gesündere, gerechtere und lebenswertere Gesellschaften schaffen, in denen unser gemeinschaftliches Wohlergehen Vorrang vor grenzenlosem Wachstum hat – vorausgesetzt, wir gestalten die Maßnahmen sorgfältig und führen die notwendigen Diskussionen über ihre Umsetzung.
Lösungen
Die gute Nachricht ist: Der Wandel ist bereits im Gange. Um ambitionierte Politik für nachhaltigen Konsum zu verwirklichen, müssen wir drei Ansätze in den Vordergrund rücken:
Erstens müssen wir gemeinsam Verantwortung übernehmen – politische Entscheidungsträger*innen, Unternehmen und Einzelpersonen müssen alle ihren Beitrag leisten, wobei diejenigen, die Macht haben, mit gutem Beispiel vorangehen sollten. Ein Ausgangspunkt hierfür ist die kritische Hinterfragung solcher Narrative, die die gesamte Verantwortung auf einzelne Verbraucher*innen abwälzen – ein Narrativ, das ein für alle Mal ad acta gelegt werden sollte. Mit Blick auf die Zukunft brauchen wir stattdessen ein ganzheitliches und vernetztes Verständnis von Verantwortung, das durch Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen einen transformativen Wandel fördert und bestehende Machtungleichgewichte anerkennt. Europäische Städte experimentieren bereits mit partizipativer Klimabudgetierung und zeigen damit, dass kollektive Verantwortung möglich ist.
Zweitens muss soziale Gerechtigkeit tiefgreifend mit ökologischer Nachhaltigkeit verknüpft werden. Sozial- und Umweltpolitik werden viel zu oft als getrennte, sogar gegensätzliche Bereiche betrachtet. Initiativen wie die Partnerschaft „Wellbeing Economy Governments“ zeigen, dass Maßnahmen, die sowohl ökologische als auch soziale Belange berücksichtigen, nicht nur möglich, sondern für langfristiges Wohlergehen notwendig sind. Akteur*innen, die sich für Nachhaltigkeit und nachhaltigen Konsum einsetzen, sollten Narrative, die ökologische und soziale Dimensionen voneinander trennen, kritisch hinterfragen. In vielen Fällen sind beide Dimensionen eng miteinander verknüpft, wenn ein Konzept dies nicht berücksichtigt, sollte es aus einer ganzheitlicheren Perspektive neu bewertet werden.
Drittens müssen lokale Innovationen ausgeweitet werden. Starke Politiken für nachhaltigen Konsum erfordern einen verantwortungsbewussten demokratischen Staat, der Hindernisse für den Wandel beseitigt, das Wohlergehen der Gesellschaft über das Wirtschaftswachstum stellt und Strukturen schafft, die nachhaltigen Konsum und nachhaltige Versorgung ermöglichen. Erste Veränderungen finden auf allen Ebenen statt. Von der Arbeitszeitverkürzung in Schweden bis zur Fahrradinfrastruktur in Paris zeigen lokale Experimente, wie kleine Veränderungen größere Transformationen vorantreiben und den Weg für systemischen Wandel ebnen können. Auch wenn sie nicht ohne Widersprüche sind, zeigen diese Modelle, dass die Priorisierung kollektiven Wohlergehens durch politische Gestaltung nicht utopisch, sondern realisierbar ist. Sozialer Wandel kommt aus allen Richtungen.
Diese Beispiele aus der Praxis unterstreichen, dass die Implementierung starker Politiken für nachhaltigen Konsum nicht nur ein theoretisches Ziel ist, sondern ein greifbarer, sich weiterentwickelnder Prozess. Obwohl noch Herausforderungen bestehen, zeigen neue Praktiken, dass Wandel bereits im Gange ist und ausgeweitet, angepasst und institutionalisiert werden kann.
Dieser Blogbeitrag basiert auf dem Kapitel „Strong Sustainable Consumption Policies” (Starke Politiken für nachhaltigen Konsum), verfasst von Lea Melissa Becker, Paula Berendt und Doris Fuchs für den Sammelband „Dispelled: Myths about Sustainable Consumption” (Widerlegt: Mythen über nachhaltigen Konsum), herausgegeben von Oksana Mont und voraussichtlich 2026 bei Routledge erscheinend. Begleitend zum Buch wird im November 2025 ein Massive Open Online Course starten, der auch dieses Kapitel behandelt.
Medien
Video mit Lea Becker und Paula Berendt: Gefährdet eine entschlossene Nachhaltigkeitspolitik Freiheit und Wohlergehen?